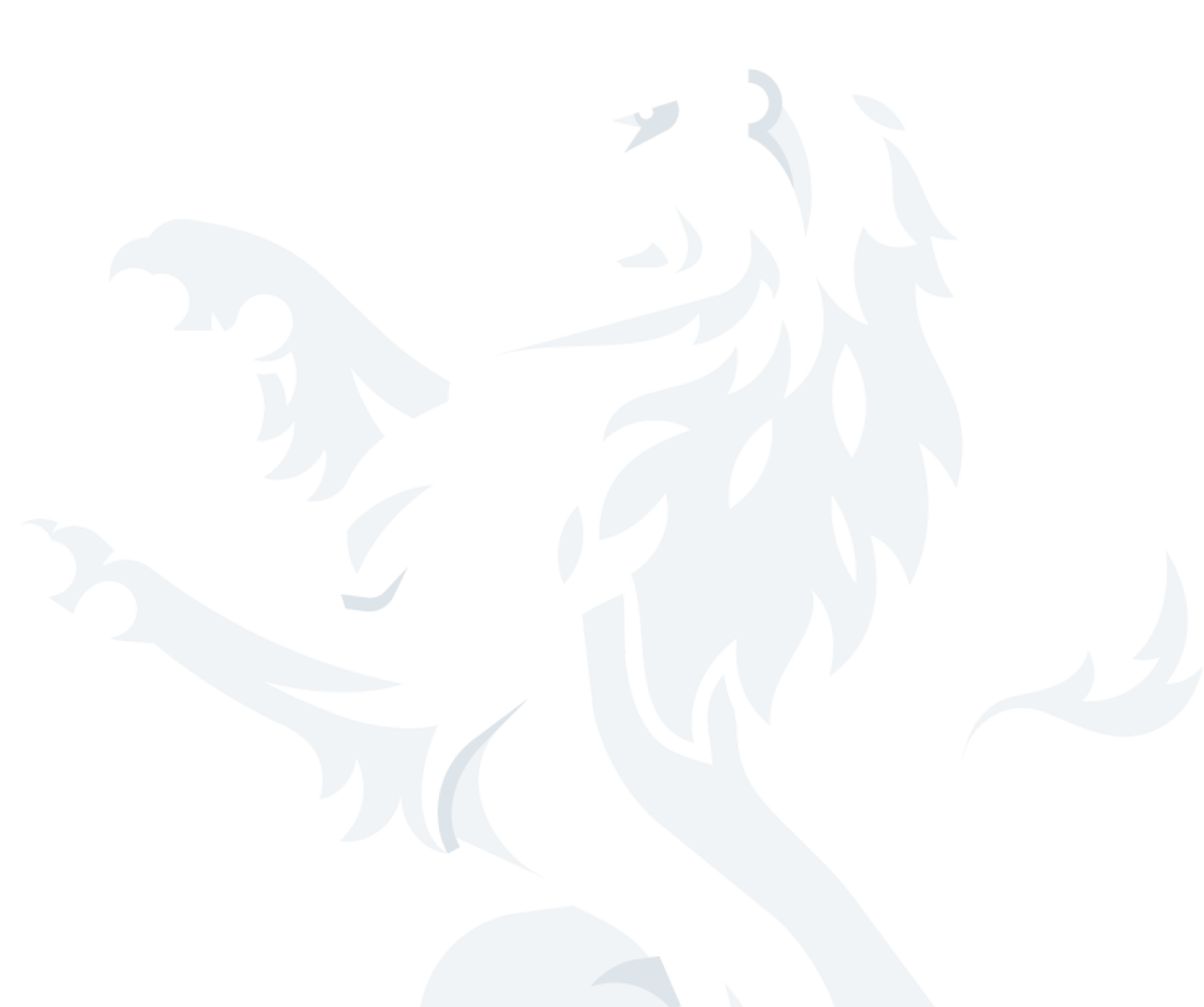Zähringer Brief September 2025
Gleichgewicht von
Wert und Preis
«In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine.» Dieses bekannte Zitat von Benjamin Graham, dem Begründer der fundamentalen Wertpapieranalyse, bringt den Kern der Aktienbewertung prägnant auf den Punkt. Kurzfristig werden Börsenkurse stark von der allgemeinen Stimmung sowie von Emotionen wie Angst und Gier beeinflusst. Langfristig setzt sich jedoch – wie auf einer Waage – das Gleichgewicht zwischen Preis und fundamentalem Wert durch.
Die Bewertung von Wertpapieren folgt stets demselben Grundprinzip: Zukünftig erwartete Zahlungsströme werden über einen angemessenen Kapitalkostensatz diskontiert und in einen heutigen Barwert übersetzt (Discounted-Cash-Flow-Methode, vgl. Box). Die Bewertung von Aktien ist keine exakte Wissenschaft, sondern vielmehr ein strukturierter Prozess unter Unsicherheit. Aktionärinnen und Aktionäre partizipieren am wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens und haben einen Residualanspruch auf das, was nach Abgeltung von Lieferanten, Löhnen, Schuldzinsen, Steuern und weiteren Aufwänden unter dem Strich als Gewinn übrigbleibt. Im Gegensatz zu Obligationen mit den vertraglich fixierten Zahlungsströmen sind diese Mittelflüsse unsicher und ihre Einschätzung bleibt zwangsläufig subjektiv. Es geht um eine Beurteilung der künftigen Ertragskraft, die heute niemand mit Gewissheit kennt. Der Unternehmenswert reagiert dabei sehr sensitiv auf die getroffenen Wachstumsannahmen. Die Preisbildung gleicht deshalb einem ständigen Seilziehen zwischen Optimisten und Pessimisten. Die Kurse an den Märkten spiegeln zu jedem Zeitpunkt den Konsens wider, der sich aus diesen unterschiedlichen Einschätzungen ergibt.
Bewertungs-Multiples zur Orientierung
Marktpreise erlauben Rückschlüsse darüber, wer beim Seilziehen die Oberhand hat. Eine einfache Orientierung bieten sogenannte Bewertungs-Multiples, die den Aktienpreis ins Verhältnis zu einer finanziellen Grösse des Unternehmens setzen, zum Beispiel dem Gewinn, dem Buchwert oder dem Umsatz pro Aktie.

Verhältniszahlen sind stets im Kontext zu deuten. Ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bedeutet, dass Anlegerinnen und Anleger bereit sind, in Relation zum erwirtschafteten Gewinn viel für eine Aktie zu bezahlen. Das ist oft dann der Fall, wenn sie ein starkes Wachstum erwarten. So verdienen dynamisch wachsende Technologiewerte beispielsweise ein höheres KGV als Unternehmen aus dem Versorgersektor. Dasselbe gilt für Aktien mit hoher Gewinnqualität, also einer stabilen und konsistenten Ertragslage, im Vergleich zu Unternehmen mit stark schwankenden Ergebnissen und vielen Sondereffekten. Ein tiefes KGV kann auf eine Unterbewertung hindeuten, aber auch sinkende Gewinne oder Risiken vorwegnehmen.
Aufschlussreich sind Bewertungs-Multiples im Branchenvergleich. Sie machen Unterschiede zwischen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen, Risiken und Wachstumsprofilen sichtbar und laden zur qualitativen Einordnung ein.
Auch die historische Entwicklung der Verhältniszahlen erlaubt Rückschlüsse auf Optimismus und Pessimismus im Markt. Sie zeigt, ob ein Unternehmen oder eine Branche im Vergleich zur eigenen Vergangenheit teuer oder günstig bewertet ist. Ein eindrückliches Beispiel, wie stark sich Wachstumserwartungen über die Zeit verschieben können, ist die Telekombranche: Zur Jahrtausendwende trieb die Interneteuphorie die KGVs vieler Unternehmen in schwindelerregende Höhen, bevor sie später in den einstelligen Bereich zurückfielen.
Für die Rendite ist stets die Entwicklung im Vergleich zu den im Preis enthaltenen Erwartungen entscheidend. Eine Neubewertung kann die Kurse stärker beeinflussen als die Gewinnentwicklung. Werden zu optimistische Annahmen korrigiert, können Aktienpreise trotz steigender Gewinne deutlich fallen (vgl. Novo Nordisk im Artikel Portfolioimplikationen).
Vergleich auf Gesamtmarktebene
Bewertungs-Multiples lassen sich auch auf Gesamtmarktebene beobachten und vergleichen. Die Abbildung zeigt aggregierte Werte für verschiedene Regionen. Abgetragen sind sowohl die Gewinn- als auch die Dividendenrendite des Gesamtmarktes. Als Prozentzahlen lassen sie sich mit Renditen anderer Anlageklassen
vergleichen, zum Beispiel Obligationen.
Beachtliche regionale Bewertungsunterschiede
Die Zeitreihen machen die regionalen Bewertungsunterschiede deutlich. Dabei fällt auf, wie komprimiert die Gewinnrendite in den USA aufgrund der hohen Bewertung des Marktes mittlerweile ist. Sie liegt nur noch unwesentlich über 4%. Zum Vergleich: In der Schweiz bewegte sie sich in den letzten zehn Jahren konstant zwischen 5 und 7%, was einem KGV von 15 bis 20 entspricht. Ein Teil der US-amerikanischen Bewertungsprämie lässt sich durch die Sektorenzusammensetzung und das hohe Gewicht der grossen Technologiefirmen erklären, die in den vergangenen Jahren ein überlegenes Gewinnwachstum erzielt haben. Eine Analyse auf Branchenebene zeigt jedoch, dass in den USA jede einzelne Branche teurer bewertet ist als im Rest der Welt.
Auch der Vergleich mit der Rendite zehnjähriger Staatsanleihen ist aufschlussreich: Während die Gewinnrendite in der Schweiz und Europa rund 4 bis 5% über der verzinslichen Rendite liegt – ein normaler Aufschlag angesichts der höheren Schwankungen –, befindet sie sich in den USA aktuell sogar darunter. Neben der hohen Aktienbewertung signalisiert diese Konstellation auch einen Renditeaufschlag, den Gläubiger für US-Staatsanleihen mit langer Zinsbindung mittlerweile verlangen.
Dass der Zins als Preis des Geldes für die Bewertung aller Vermögenswerte eine zentrale Rolle spielt, ist anhand dieser Zahlen ebenfalls erkennbar. Mit dem Anstieg des Zinsniveaus im 2022 kamen die Aktienbewertungen unter Druck. Die KGVs bildeten sich zurück und die Gewinnrenditen legten im Umkehrschluss zu.
Historisch besteht ein inverser Zusammenhang zwischen dem Bewertungsniveau und den in den Folgejahren realisierten Aktienrenditen. Dieser wirkt zwar nicht kurzfristig und ist deshalb kein geeigneter Timing-Indikator, wohl aber für einen längeren Zeithorizont. Hohe KGVs – respektive tiefe Gewinnrenditen – deuten auf eine tiefere langfristige Renditeerwartung hin. Sowohl die aktuellen Dividenden- als auch Gewinnrenditen sprechen für ein grosszügiges Gewicht von Aktien aus der Schweiz und Europa.
Implikationen für die Vermögensverwaltung
In unserem Vermögensverwaltungshandwerk ist die Bewertung – neben der Qualität und der Unternehmensführung – ein wichtiges Kriterium bei der Selektion von Einzelaktien und der Bestimmung der regionalen Vermögensaufteilung. Im Unterschied zu reinen «Value »-Investoren ist die Bewertung für uns jedoch nicht das alles dominierende Kriterium. «Value»-Investoren nach der Schule von Benjamin Graham suchen eine besonders hohe Sicherheitsmarge zwischen bezahltem Preis und geschätztem innerem Wert und finden deshalb in wachstumsorientierten Branchen kaum Anlageopportunitäten. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass die Waage zwischen Preis und Wert lange im Ungleichgewicht bleiben kann und stattlich bewertete Unternehmen noch teurer werden können. In den vergangenen 15 Jahren war vor allem Wachstum gefragt. «Value » hatte im Vergleich zu «Growth» einen schweren Stand. Wir sind überzeugt, dass Diversifikation deshalb nicht nur über Regionen und Sektoren, sondern auch über Anlagestile hinweg sinnvoll ist.
Darüber hinaus gibt es günstig bewertete Unternehmen, die unserem Kriterium der Qualität nicht genügen und deshalb nicht berücksichtigt werden. Banken zählen beispielsweise weiterhin dazu. Zwar gehören Bankaktien in diesem Jahr zu den besten Performern, weil sie nicht nur positives Gewinnwachstum aufweisen, sondern auch eine Neubeurteilung der Bewertung stattfand. Dennoch sehen wir keinen Anlass, prozyklisch unsere Haltung zu ändern. Grosse Banken bleiben aufgrund ihres hohen Fremdkapitalanteils in der Bilanz äusserst verletzlich. Diese geringe Fehlertoleranz macht sie krisenanfällig und nach unserer Einschätzung ungeeignet für ein langfristiges Engagement.
Interessantere Anlagemöglichkeiten sind aktuell in den defensiven Branchen Nahrungsmittel und Gesundheit zu finden. Beide werden derzeit mit einem Bewertungsabschlag gehandelt und sind im historischen Vergleich günstig. Gerade im Gesundheitssektor ist der Pessimismus aufgrund der politischen Risiken hoch, während die langfristigen Nachfragetreiber unverändert attraktiv bleiben.
Die mittlerweile eingepreiste Erwartung deutlich sinkender US-Leitzinsen – unter erheblichem politischem Druck – verleiht den Märkten Rückenwind. Zahlreiche Aktienmärkte notieren in Lokalwährung in der Nähe ihrer Höchststände, während die Kreditrisikoprämien auf historisch tiefem Niveau liegen. In einem von Optimismus geprägten Marktumfeld – mit erheblichen Unsicherheiten – schöpfen wir die strategischen Aktienquoten weiterhin aus, achten aber auf eine wohldurchdachte Positionierung, bei der auch die defensiven Elemente nicht zu kurz kommen.
Portfolioimplikationen
Gleichgewicht von
Wert und Preis
Gerne stellen wir Ihnen an dieser Stelle zwei Anlagemöglichkeiten vor, die unsere Selektionskriterien für ein diversifiziertes Wertschriftenportfolio erfüllen.